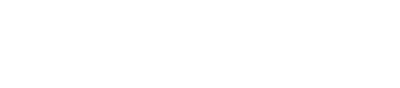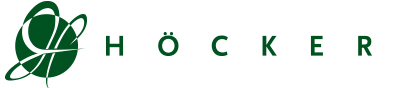Woran denken Sie, wenn Sie den Namen Patricia Schlesinger hören? An Begriffe wie „Korruption“? „Verschwendung“? „Gier“? Irgendwas mit Massagesesseln? Wenn ich als Medienanwalt der früheren RBB-Intendantin auf dieses Mandat angesprochen werde, fallen meist solche Stichworte. Kaum jemand weiß im Detail, was ihr eigentlich vorgeworfen wird, aber fast alle haben abgespeichert, dass Schlesinger jedenfalls überaus kritisch zu betrachten sei. Denn immerhin wird seit Jahren sehr kritisch über sie berichtet. Es lohnt sich, einen Blick darauf zu werfen, wie die Wirklichkeit und das medial vermittelte Bild von Patricia Schlesinger sich zueinander verhalten. Wer ist diese Frau und was ist während ihrer Zeit beim RBB geschehen?
Ein Rückblick: Die Erfolge der gefeierten Intendantin
Patricia Schlesinger wurde 2016 als Intendantin des RBB angeworben, um den Hauptstadtsender sichtbarer und innerhalb der ARD-Anstalten relevanter zu machen. Zudem sollte sie das Fernsehprogramm reformieren, die Rolle des RBB in Berlin und Brandenburg stärken und die Multimedialität ausbauen.
Das waren Schlesingers Aufgaben. Und sie lieferte:
– Sie holte das ARD-Mittagsmagazin nach Berlin. Der Marktanteil stieg. Der Spiegel lobte sie: Es sei eine kleine Sensation, wenn der RBB das neue ARD-Mittagsmagazin im ZDF-Hauptstadtstudio produziere.
– „Kontraste“ vom RBB wurde zum erfolgreichsten Politikmagazin der ARD
– RBB-Produktionen bekamen Preise und wurden für Oscar und Emmy nominiert.
– Der RBB erhielt erstmals den Posten des stellvertretenden Chefredakteurs im Berliner Hauptstadtstudio.
– Brandenburg erhielt 14 neue Regionalkorrespondenten.
– Der RBB sollte vom WDR die Federführung des ARD-Studios in Warschau übernehmen: sein erstes eigenes Auslandsstudio.
– Schlesinger stärkte finanziell und personell die investigative Berichterstattung und schuf eine crossmediale Investigativredaktion.
– Im Netz wurde der RBB mit rbb24, rbbkultur und crossmedialen Sport-Angeboten deutlich präsenter.
– Der Marktanteil des RBB-Fernsehprogramms stieg von 5,4 Prozent im Jahr 2016 auf 6,3 Prozent im Jahr 2021.
Schlesingers Erfolge blieben nicht unbemerkt. Der NDR versuchte, sie als Intendantin abzuwerben. Auch die Leitung von SWR, BR und ZDF wurde ihr angetragen. Alle diese Posten waren deutlich besser dotiert als ihrer. Dem RBB waren die ständigen Abwerbeversuche nicht verborgen geblieben. Er appellierte an die Intendantin, in Berlin zu bleiben, denn unzufrieden mit ihrer Arbeit war man damals ganz und gar nicht – im Gegenteil: Sie wurde 2021 mit überragender Mehrheit für eine zweite Amtszeit wiedergewählt: „Patricia Schlesinger hat mit ihrem Team weitreichende Veränderungen klug und erfolgreich auf den Weg gebracht“, lobte die Vorsitzende des Rundfunkrates. Die Wiederwahl sei ein „gutes Signal für das Publikum des RBB“.
Und so entschied sich Patricia Schlesinger stets dafür, „ihre Aufgaben beim RBB zu Ende zu bringen“. „Karrieretourismus“ liege ihr nicht, so formulierte sie es.
Das digitale Medienhaus
Für die Zukunft hatte die Intendantin weitere Pläne, um – ihrem Auftrag gemäß – die Relevanz des RBB zu stärken: Ähnlich wie bei der privaten Konkurrenz vom Springer-Verlag und in anderen öffentlich-rechtlichen Sendern sollte ein Digitales Medienhaus (DMH) mit einem modernen Newsroom als journalistischem Herzstück gebaut werden, um den RBB mit seinen (hoffnungslos veralteten) Strukturen baulich, personell und organisatorisch zukunftsfähig zu machen. Das DMH sollte Radio-, TV- und Onlineredaktionen vereinen.
Die Crossmedialität sollte Synergien schaffen, also effizienteres Arbeiten ermöglichen. Mit weniger Personal mehr crossmediales Programm schaffen lautete Schlesingers Credo, so steht es in den Protokollen. In Berlin herrschte allenthalben Begeisterung über die Pläne der Intendantin, in Brandenburg etwas weniger, denn das DMH sollte in Berlin entstehen. Doch die Kostenschätzungen stiegen – wie so oft bei Großprojekten – immer weiter. Schlesinger hatte stets Wert darauf gelegt, dass das DMH nicht mehr als 160 Mio. Euro kosten solle, sonst könne man gar nicht bauen, auch das steht in den Sitzungsprotokollen. Doch bald schon lagen die Prognosen deutlich höher. Gemeinsam versuchte die RBB-Geschäftsleitung, die Kosten in den Griff zu bekommen. Von einem unnötigen „Prestigeprojekt“ oder gar einer Zerrüttung des Verhältnisses zwischen Patricia Schlesinger und dem RBB und seinen Gremien war aber noch lange keine Rede. Und ja, die Gremien waren – entgegen der jetzt gängigen Behauptungen – natürlich eingebunden und hätten jederzeit noch mehr Informationen von der Geschäftsleitung und von der Intendantin einfordern können; das schien ihnen aber nicht nötig zu sein.
Der Beginn der medialen Kampagne gegen Patricia Schlesinger
Schließlich nahm sich die Intendantin eines besonders herausfordernden und zukunftsträchtigen Projekts an: Nach dem Vorbild von CNN sollte „tagesschau24“ endlich zu einem ernstzunehmenden 24/7- Nachrichtensender ausgebaut werden. Auch der Springer-Verlag versuchte, mit Welt TV und Bild TV auf dem Markt erfolgreich zu sein. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist bekanntermaßen seit langem ein Dorn im Auge des Springer-Konzerns. Nun galt dies erst recht.
Und dann begann die Berichterstattung des Springer-Verlages, die alles änderte. Business Insider und Bild- Zeitung starteten einen medialen Feldzug, der schnell von Medien jeglicher politischen Couleur aufgegriffen wurde.
Die Rede war von Korruption, Verschwendung und Gier beim RBB. Und diese Etiketten blieben vor allem an Patricia Schlesinger kleben. Denn überall las man seither vom „Fall Schlesinger“, von der „Schlesinger-Affäre“ oder gleich vom „Schlesinger-Skandal“.
Wie kam es dazu, dass dieser Fall in der öffentlichen Meinung nicht im Geringsten polarisierte, sondern dass Journalisten aller politischen Richtungen im Grunde das Gleiche schrieben?
Zum einen entspricht es einer medialen Logik, Geschichten zu personalisieren, ihnen ein „Gesicht“ zu geben: Denn Menschen interessieren sich vor allem für andere Menschen, ihr Leben und ihre Schicksale. Eine Intendantin, die sich angeblich einen Massagesessel bestellt und deshalb entlassen wird, ist interessanter als ein Bericht über Gremien, die über mögliche Baukostensteigerungen diskutieren. Doch auch die politische Großwetterlage begünstigte die Einseitigkeit der Berichterstattung: Das konservative bis (sehr) rechte Lager schäumte sowieso vor Wut, als die Berichte über angebliche Korruption im RBB erschienen.
Doch auch ÖRR-freundliche linksliberale Medien nahmen das Narrativ von der angeblich so verschwenderischen Intendantin gerne auf: Durch die Umlenkung der Aufmerksamkeit weg vom RBB und der ARD hin zu einem persönlich verantwortlichen „Bauernopfer“ schützten sie den öffentlich-rechtlichen Rundfunk vor den beständigen Angriffen von rechts.
Und so kursierten immer absurdere Berichte und Gerüchte über Patricia Schlesinger.
• Es stand zu lesen, dass sie eine Villa am Schlachtensee besitze.
• Es ging das Gerücht herum, sie habe den RBB einen Karibik-Urlaub im Privatjet in Höhe von 50.000 Euro bezahlen lassen.
• Ihrem Mann habe sie einen Beratervertrag beim RBB besorgt.
Nichts davon stimmte.
Doch ARD und RBB erkannten schnell, dass öffentliche Erregung unabhängig davon ein Problem ist, ob sie sachlich gerechtfertigt ist oder nicht. Es geschah also das, was Experten für Krisen-PR in solchen Fällen empfehlen: Wenn sich eine Reputationskrise auf eine einzelne Person konzentrieren lässt, soll man diese zum Sündenbock machen, sich von ihr trennen und auf sie eindreschen. So lenkt man von sich selbst ab. Und genau das tat der RBB: Nachdem Patricia Schlesinger ihr Amt bereits niedergelegt hatte, feuerte der Sender sie medienwirksam vor der Untersuchung der Vorfälle und strich ihr die in mehr als 30 ARD-Jahren erarbeitete Betriebsrente. Das DMH wurde gestoppt und der RBB auf einen personal- und kostenintensiv produzierenden, technisch kaum zukunftsfähigen Regionalsender zurückgestutzt, der in der „ARD-Familie“ niemanden bedroht. Das „Mittagsmagazin“ wurde an den MDR gegeben, der WDR führt nun wieder das ARD-Büro in Warschau. Die alte Machtverteilung innerhalb der ARD war wieder hergestellt.
Zur Begründung des Rauswurfs zeichnete der RBB von Schlesinger im Nachhinein das Bild einer skrupellosen, selbstoptimierenden, verschwenderischen und unfähigen Managerin. Mit einem Millionenaufwand für externe Anwälte – der Sender beschäftigt inzwischen die dritte Kanzlei, um vielleicht doch noch etwas gegen die frühere Intendantin zu finden – drehte der Sender jeden Stein um und versuchte zu beweisen, dass Patricia Schlesinger die Wurzel allen RBB-Übels sei. Das ging so weit, dass er ihr sogar empört vorwarf, ihr Vertrag sei sittenwidrig. Wohlgemerkt: Gemeint ist der Standardvertrag, den der Arbeitgeber RBB der Arbeitnehmerin Schlesinger – und nicht nur ihr, sondern auch schon ihrer Vorgängerin – selbst vorgelegt hatte und den sie nicht veränderte.
So entstand ein vielstimmiges, aber inhaltlich einheitliches Medienkonzert, das zu einer vollständigen Vorverurteilung Schlesingers in der öffentlichen Meinung führte. Niemand hatte ein Interesse daran, ihr zur Seite zu springen. Der ehemalige BGH-Richter Thomas Fischer schrieb im Spiegel von der Eigengesetzlichkeit der Branche, die auf „den Durchlaufverzehr von Lebensschicksalen nicht nur spezialisiert, sondern von ihm hochgradig abhängig ist.“
Die einzige Ausnahme war Die Zeit, die zwei Redakteuren viel Raum für eine unvoreingenommene Recherche gab. Sie sprachen mit rund vierzig Menschen, RBB-Mitarbeitern, anderen Intendanten, Gremienmitgliedern und Politikern, lasen Protokolle und Mails, Verordnungen, Verträge und Berichte. Sie kamen zu dem Urteil, dass der eigentliche Skandal die Skandalisierung des Falles Schlesinger sei.
Der Showdown vor Gericht
Vor dem Landgericht Berlin klagt Patricia Schlesinger inzwischen darauf, ihre Altersversorgung zu erhalten. Umgekehrt verlangt der RBB von ihr viele Millionen Euro Schadenersatz. Am 15. Januar 2025 trafen die Parteien vor Gericht aufeinander. Die Erwartungshaltung in Medien und Öffentlichkeit war infolge der mehrjährigen Vorberichterstattung und Vorverurteilung klar: Der RBB würde siegreich sein, Patricia Schlesinger verlieren.
Dann ging es ins Detail: Die falschen Korruptionsvorwürfe, die die Berichterstattung überhaupt erst ins Rollen gebracht hatten, waren nicht mehr Gegenstand des Verfahrens; es gab schlicht keine Korruption, keine Vetternwirtschaft. Als Ersatzvorwürfe dienten etwa der Massagesessel auf der Intendantenetage, den Schlesinger nie bestellt und nie benutzt hat, sowie Abendessen auf Senderkosten, bei denen sie das vom Sender erwartete Networking betrieb. Außerdem ging es um einen (äußerst günstig geleasten) Dienstwagen mit – Massagesitzen. Patricia Schlesinger hatte den Wagen weder selbst konfiguriert, noch leidet sie an Rückenproblemen. Dass andere Intendanten größere, teurere Dienstwagen fuhren (zum Beispiel die Chauffeur-Limousine von Audi) hat übrigens nie jemanden interessiert.
Außerhalb des Verfahrens musste sich die frühere Intendantin am Ende sogar gegen den Vorwurf wehren, Gummibärchen falsch abgerechnet zu haben. Manch einer fühlte sich an das „Bobby Car“ erinnert, das der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff einst als Geschenk für seinen Sohn entgegengenommen hatte, wofür er hart kritisiert wurde. Das Gericht ließ sich von diesen Vorwürfen wenig beeindrucken. Zur Überraschung der in großer Zahl erschienenen Journalisten verlief der Termin ganz anders als erwartet. Das Gericht befand, die Anträge des RBB seien entweder unzulässig oder unschlüssig oder unbegründet.
Der medialen Berichterstattung über den Verhandlungstermin ließ sich allerdings kaum entnehmen, was im Gerichtssaal tatsächlich geschehen war. Vielen Journalisten fiel es womöglich schwer, sich von der Vorstellung zu verabschieden, dass Frau Schlesinger eine Täterin und der RBB ein Opfer ist.
Folgen der Berichterstattung und Resümee
Inzwischen verhandeln die Prozessparteien zwar über eine gütliche Einigung, aber die aufgeheizte Debatte und die unrealistischen Erwartungen, die durch die einseitige Berichterstattung in der Öffentlichkeit entstanden sind, sind nicht folgenlos geblieben. Sie erschweren die Suche nach einer Lösung.
Der „Fall Schlesinger“ taugt letztlich als Musterbeispiel für eine einseitige, personalisierte Medienkampagne, in der eine zunächst gefeierte Person plötzlich tief stürzt und als Sündenbock und Bauernopfer herhalten muss, weil praktisch alle Beteiligten mehr als zufrieden sind, wenn aus einem tatsächlichen oder vermeintlichen RBB-Skandal ein Schlesinger-Skandal fabriziert wird, der tatsächlich oder vermeintlich alle Zutaten aufweist, die einen Skandal so spannend machen: Geld, Gier, Verbrechen, Politik und große persönliche Fallhöhe.
Und der Fall zeigt auch, welche Gefahren mit einer solchen Kampagne verbunden sind. Wenn praktisch alle Medien das Gleiche über eine rechtliche Auseinandersetzung berichten, sich dabei aber irren, kann dies negative Folgen nicht nur für die Glaubwürdigkeit der Medien, sondern auch für den Rechtsstaat haben. Denn nicht jeder Richter ist so souverän wie die Kammer des Landgerichts Berlin, die die Vorwürfe gegen Patricia Schlesinger erkennbar frei von medialer Beeinflussung bewertet hat.
Und natürlich sind auch Prozessparteien auf der Suche nach einer gütlichen Einigung nicht immer ganz unbefangen, wenn sie unter massiver Beobachtung einer Öffentlichkeit stehen, die ganz bestimmte Erwartungen an den Verfahrensausgang hat.
Medien und Mediennutzer müssen sich im Klaren darüber sein, dass ein Rechtsstreit ganz anders enden kann als erwartet. Das klingt in der Theorie banal, ist in der Praxis aber keineswegs selbstverständlich. Es steht in unserer Verantwortung und es ist in unser aller Interesse, sich dies aktiv bewusst zu machen, wenn wir wieder einmal glauben, schon genug über einen Fall zu wissen.
Hinweis: Dieser Artikel erschien zuerst am 1.3.2025 in der Berliner Zeitung.